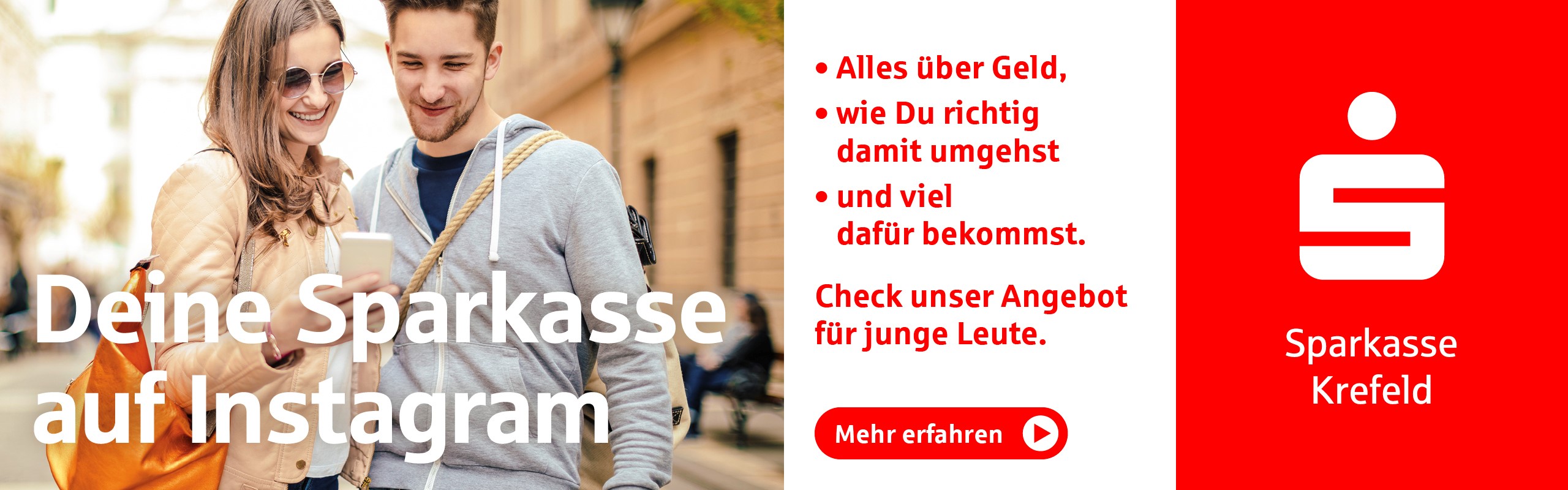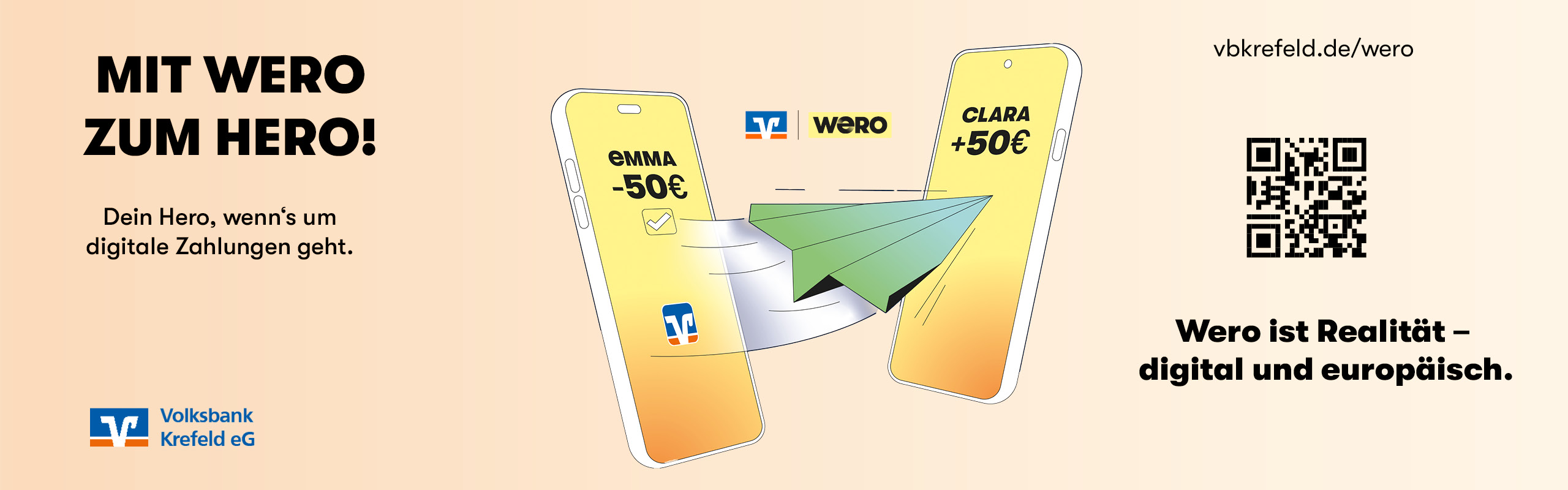Durch die Medien sind wir mit der gesamten Welt verbunden. Ob Flugzeugabsturz in Indien oder Waldbrände in Südspanien – alles nur ein paar Klicks entfernt. Trotzdem gilt auch heute noch, dass das Gefühl der Betroffenheit stark von persönlichen Beziehungen zu den Beteiligten abhängt. Habt ihr Verwandte in Indien oder eure Schwester macht gerade in Andalusien Urlaub – schon bekommt die Nachricht eine ganz andere Bedeutung. Emotional verstärkend können sich auch historische Erfahrungen oder gefühlte Gemeinsamkeiten auswirken. Das habe ich jetzt in unserem Sommerurlaub in Estland erfahren. Dort hingen an nahezu jedem Amtsgebäude ukrainische Fahnen – meist in Kombination mit der estnischen und manchmal auch der Europafahne. Vor der russischen Botschaft in der Hauptstadt Tallinn hing eine lange Reihe von Protestplakaten gegen den „blutigen russischen Imperialismus“. Ein Polizeiposten schützt das Gebäude vor Übergriffen. Eine über 80-jährige Frau erzählte uns am Strand, wie sie in der Jugend gezwungen war, russisch zu sprechen und zu schreiben. Erschwert wird die Situation noch dadurch, dass in Estland etwa jeder vierte russische Wurzeln hat. Für die meisten von uns ist der Krieg in der Ukraine schrecklich anzusehen, aber doch irgendwie weit weg. Das ändert sich, wenn man in einer ehemaligen Sowjetrepublik lebt, die sich von der „Heim-ins-Reich-Politik“ im Kremlkonkret bedroht fühlt. Wenn ihr euch also demnächst wundert, warum Menschen „so emotional“ auf ein Ereignis reagieren, fragt euch, welche persönliche Beziehung sie dazu haben. Die Reaktion ist oft eine Frage des Abstands.
Foto: Pexels / Paolo Boaretto